AVIVA-Berlin >
Women + Work > Lokale Geschichte_n
AVIVA-BERLIN.de im Februar 2026 -
Beitrag vom 15.10.2014

Ayse-Gû¥l Yilmaz und Judith Tarazi
A. Yildirim, J.Tarazi
Beide Frauen arbeiten im sozialen Bereich. Viel mehr wussten sie nicht û¥bereinander, als sie sich in der AVIVA-Redaktion trafen. "Du bist erst die zweite Jû¥din, mit der ich bewusst spreche" ...
..., fiel Ayse-Gû¥l auf. Im GesprûÊch fanden sich viel Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede.
Warum soziale Arbeit? ã Wege zum Beruf
Judith Tarazi:
Ich weiû noch gar nicht so viel û¥ber dich, auûer, dass du mit Jugendlichen arbeitest.
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Ich habe an der TU Berlin studiert, Erziehungswissenschaften und als NebenfûÊcher Deutsch als Fremdsprache und Soziologie. Nach dem Abschluss habe ich theaterpûÊdagogisch im FrauengefûÊngnis gearbeitet, wir haben "Die Nibelungen" im Saalbau NeukûÑlln aufgefû¥hrt. Dann habe ich in KindergûÊrten gearbeitet, aber das war nicht so mein Fall (lacht). Ich habe viel mit schuldistanzierten Kindern gearbeitet, ErwachsenenpûÊdagogik habe ich auch gemacht, aber ich habe gemerkt, dass ich lieber mit Jugendlichen arbeite.
Judith Tarazi:
Das ist interessant, weil dein Studium ja eher theoretisch war ã es klingt, als hûÊttest du dich direkt in die praktische Arbeit gestû¥rzt.
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Genau. Eigentlich wollte ich SozialpûÊdagogik studieren, aber mein NC hat nicht gereicht ã ich hûÊtte fast sechs Wartesemester gehabt.
Wenn das VorstellungsgesprûÊch gut lûÊuft, beginne ich im Februar mit der Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin ã also gehe ich weiter in die Praxisrichtung. Ich habe auch frû¥her schon û¥berlegt, Psychologie zu studieren, habe das aber wegen des NC nicht gemacht.
Judith Tarazi:
Wir haben einige Gemeinsamkeiten (lacht). Ich konnte mich nie zwischen Kunst und Psychologie entscheiden. Mein Abi war aber vûÑllig unterirdisch. Und dann habe ich Erziehungswissenschaften studiert und Psychologie im Nebenfach. Aber das war mir zu theoretisch. Ich bin nicht so der wissenschaftliche Typ. Also hab ich irgendwann aufgehûÑrt und Grafikdesign gelernt. SpûÊter habe ich das kombiniert: Ich habe lange als Grafikerin gearbeitet und dann eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin gemacht, und in dem Beruf arbeite ich jetzt auch. Ich arbeite mit behinderten Menschen.
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Ich betreue auch einen Jungen mit Down-Syndrom.
Der Umgang mit Behinderung in verschiedenen Kulturen
Judith Tarazi:
Ich leite ein Atelier, eine kû¥nstlerische Tagesbetreuung der ZWST (Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland). Das ist die jû¥dische Wohlfahrtsorganisation, wie das Rote Kreuz oder der ParitûÊtische Wohlfahrtsdienst. Das Projekt ist relativ neu, weil der grûÑûte Anteil der Mitglieder der jû¥dischen Gemeinde ja erst Mitte der Neunziger nach Deutschland gekommen ist. Die meisten kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Wie in allen Gruppen gibt es da natû¥rlich auch behinderte Menschen, und die ZWST hat ganz vorsichtig angefangen, sich darum zu kû¥mmern. Das ist ein besonders schwieriges Feld, weil der Umgang mit Behinderung in der Sowjetunion sehr speziell war, noch mal anders als hier. In der Sowjetunion gab es nie Euthanasieprogramme, aber es gab diese starke Trennung. ûberhaupt keine Integration, sondern eine absolute Abspaltung von Behinderten und Nichtbehinderten.
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Radikale Exklusion sozusagen.
Judith Tarazi:
Absolut. Viele Menschen haben Anfang der Neunziger û¥berhaupt zum ersten Mal Behinderte gesehen, weil sie im Straûenbild einfach û¥berhaupt nicht prûÊsent gewesen sind. Sie kamen in Heime, wurden untergebracht...
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Ist die Zielgruppe religiûÑs homogen? Nur damit ich den Kontext verstehe.
Judith Tarazi:
Die Leute, die ich betreue, sind jû¥disch, fast alle aus der ehemaligen Sowjetunion, und es sind Erwachsene, von 21 oder 22 bis 70. Es sind ungefûÊhr 15 Leute, die mehr oder weniger regelmûÊûig kommen. Es ist insofern besonders schwierig, weil die meisten zwar erwachsen sind, aber mit ihren hochbetagten Eltern zusammenleben. Oft ist nur noch ein Elternteil da, meistens die Mutter, das sind oft sehr symbiotische VerhûÊltnisse. Das heiût, man muss auch ganz viel AngehûÑrigenarbeit leisten. Das ist die Lebensaufgabe gewesen, und sie haben oft schon mehrere Stationen durchlaufen, waren in Israel, sind hierhergekommen, und das schweiût natû¥rlich zusammen.
Und dann kommen sie hierher, in ein vûÑllig anderes Umfeld, voller ûngste, eine fremde Sprache, ein fremdes Land. Es hat ewig gedauert, Vertrauen aufzubauen, um die Leute zu ermutigen zu sagen: "Ja, ich habe ein behindertes Kind." Bei vielen ist es nach wie vor der Fall, dass sie das leugnen, dass sie sagen: "Alles in Ordnung".
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Das ist in der tû¥rkischen Kultur manchmal auch so. Manchmal wird es versteckt. Ich habe ein paar Mal mitbekommen, dass es komplett ignoriert wurde, auch wenn Leute die Mutter, den Vater ansprechen: "Da stimmt etwas nicht." Ich kannte einen Jungen, der schizophren wurde. Er hûÑrte Stimmen, und die Eltern sagten: "Ach Quatsch, da ist nichts." Das wurde extrem, als er den Nachbarn mit einem Messer angefallen hat. Er sagte, das haben ihm die Stimmen gesagt. Und dann konnte man nicht mehr weggucken, denn dann sind auch die BehûÑrden plûÑtzlich da. Dann kann man das Kind nicht mehr verstecken. Aber die Mû¥tter halten oft stark an den Kindern fest: "Ich muss mich kû¥mmern, es gibt so viele bûÑse Menschen." Und wenn man sagt, es gibt Sozialarbeiter: "Es gibt so viele MissbrauchsfûÊlle.
Judith Tarazi:
Das hûÑre ich auch oft.
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Bei dem Kind mit Down-Syndrom ist es auch so: Die Mutter ist alleinerziehend, und sie vertraut ihn weder den Lehrern an, noch den Sozialarbeitern. Sie ist permanent mit dem Kind zusammen, was ihm û¥berhaupt nicht guttut. Sie sagt, dass sie niemandem vertraut. Und es hat auch mit Schamgefû¥hl zu tun: Weil das Hungergefû¥hl und der Sexualtrieb bei ihm verstûÊrkt sind, schûÊmt sie sich.
Judith Tarazi:
Meinst du denn, dass dieses mangelnde Vertrauen kulturell bedingt ist, dass es Leute gûÊbe, denen sie mehr vertrauen kûÑnnten? Sagen wir mal, es gûÊbe jetzt ein betreutes Wohnen fû¥r Muslime, wo auf bestimmte Dinge geachtet wird und wo man sich kulturell verstanden fû¥hlt. Meinst du, da wû¥rde es Zulauf geben?
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Ich denke schon, aber leider wird zu wenig angeboten und zu wenig thematisiert. Erst seit kurzem beschûÊftigen sich Muslime mit dem Thema und immer mehr Vereine bieten etwas an, aber trotzdem gibt es wenige, die diese Angebote annehmen.
Bei den Tû¥rken gibt es einen bestimmten Ausdruck, der in vielen Familien benutzt wird, das ist das Wort "ayip" ã unverschûÊmt. Wenn ich ein Kind mit Down-Syndrom habe, das stûÊndig FûÊkalwûÑrter benutzt, ist es ayip, etwas, das sich nicht gehûÑrt.
Judith Tarazi:
Darû¥ber machen wir uns gerade sehr viel Gedanken: Wir hûÊtten gern ein jû¥disches betreutes Wohnen, wo es ein kulturelles Umfeld gibt, in dem sich die Leute wohlfû¥hlen. Deswegen habe ich gefragt, ob es so etwas fû¥r Muslime gibt. Es muss doch einen Bedarf geben.
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Ich weiû aus meinem Umfeld, dass erst seit ein paar Jahren die Eltern ins Altersheim gegeben werden. Das ist eine neue Entwicklung. Egal, wie û¥berfordert man mit den Eltern ist, man hat auf sie aufgepasst. Man fû¥hrte einen Mehrgenerationenhaushalt. Ich glaube, dass vieles nicht religiûÑs bedingt ist, sondern kulturell ãeher ein sozialer Druck.
Behinderung und SexualitûÊt
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Ich habe mich mal auf dem Spielplatz mit einem ûÊlteren Mann unterhalten, der auf dem Stand eines Kindes war, und ich habe zu ihm gesagt: "Du wirst auch einmal deine groûe Liebe treffen." Seine Schwester, die ihn betreut hat, sagte zu mir: "Warum sagst du so etwas? Der wird nie heiraten." Und er hat gesagt: "Aber ich will doch so gerne!" Mit welchem Recht nimmst du ihm das weg? Vielleicht weiû er ja auch: "Ich werde nie eine Frau haben". Aber die Illusion ist da. "Irgendwann wird sich eine in mich verlieben..." Das ist eine Bevormundung.
Judith Tarazi:
Das sind ganz heikle Themen. Zu akzeptieren, dass jeder Mensch diese Bedû¥rfnisse hat, ob mit oder ohne Behinderung, das ist bei uns im Atelier ein groûes Thema: Partnerschaft und SexualitûÊt, Verlieben, Kinder haben oder nicht.
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Ich habe von einem Fall in Amerika gelesen, wo eine Mutter ihre Tochter sterilisieren lassen wollte, weil sie sexuell so aktiv war und sie Angst hatte, sie wû¥rde behinderte Kinder bekommen.
Judith Tarazi:
Die fortschrittlichen Eltern, die ich kenne, regeln das eher so, dass sie ihrer Tochter dann die Pille geben. Man muss leider sagen, dass viele Frauen in den Institutionen Missbrauchserfahrungen machen. Nicht unbedingt mit Betreuern, aber mit anderen Behinderten. Das kann man nicht immer verhindern. Und dann ist es gut zu sagen: Wir geben unserer Tochter die Pille. Das finde ich vernû¥nftig. Aber fû¥r die meisten unserer sowjetischen Eltern kommt das gar nicht in Frage. Darû¥ber wird nicht gesprochen. Wenn du dir die Niederlande ansiehst oder Kanada, da gibt es andere MûÑglichkeiten fû¥r Behinderte, freier zu leben, eine Familie zu haben oder zumindest ihre SexualitûÊt auszuleben. Es gibt ja auch Prostituierte speziell fû¥r Behinderte.
Egal, wie man zu Prostitution steht, in dem Fall ist es ja schon fast Sozialarbeit. Aber die AngehûÑrigen sind zum Teil 80, 90 Jahre alt, und ich habe VerstûÊndnis dafû¥r, wenn man sich nicht mehr in jedem Lebensalter vûÑllig verûÊndert.
Familie und Erziehung

Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Als PûÊdagogin achtet man oft zu wenig auf sich, gibt mehr, als man sollte. Ich merke jetzt, dass ich in manchen Situationen viel gelassener reagiere als frû¥her, aber das musste ich erst lernen.
Ich denke, vieles ist in der Kindheit begrû¥ndet. Wir alle hatten eine mehr oder weniger "schlimme" Kindheit. Immer mehr Jugendliche leiden an MigrûÊne, es ist keine û30-Krankheit mehr. Anscheinend ist der Druck enorm, sei es Schule oder Familie. Meinen Eltern lag die Bildung der Kinder sehr am Herzen und deshalb haben sie versucht uns von Stress fern zu halten.
Judith Tarazi:
Und wie fanden das deine Eltern, dass ihre TûÑchter so erfolgreich im Beruf sind?
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Meine Eltern haben uns sehr liberal aufgezogen und sind denke ich stolz auf uns. Sie waren und sind gute Vorbilder, sie haben immer versucht uns gute Vorbilder zu sein, egal welche Lebensphasen sie durchmachten.
Religion und Erziehung
Judith Tarazi:
Im Jû¥dischen wird das Judentum nur û¥ber die Frau weitergegeben. Du bist Jû¥din, wenn du eine jû¥dische Mutter hast oder wenn du konvertierst. Wenn du nur einen jû¥dischen Vater hast, bist du nach der Halacha, dem jû¥dischen Gesetz, nicht jû¥disch. Das ist ein Problem fû¥r manche Leute aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie haben einen jû¥dischen Vater, wurden als Juden behandelt, hatten Probleme, werden aber hier in den Gemeinden nicht als jû¥disch akzeptiert. Oft wird es ihnen dann leichter gemacht zu konvertieren, und es gibt Gruppen, die sagen, wir akzeptieren auch Vaterjuden.
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Im Islam sagt man, dass jeder als Moslem auf die Welt kommen kann. Sobald das Kind vernû¥nftig denken kann, kann es sich entscheiden. Eigentlich kommt man als weiûes Blatt auf die Welt. Ich bin ja religiûÑs aufgewachsen, es ist vorgelebt worden. Das Problem bei Konvertiten ist, dass sie alles ganz genau haben wollen, die sehen nur noch schwarz und weiû und nichts mehr grau.
Fû¥r mich persûÑnlich finde ich es anstrengend, mit einem nichtmuslimischen Mann zusammen zu leben. Meistens sind die Kinder dann ã je nach dem Engagement der Eltern ã zweigeteilt, und meistens sind sie dann am Ende Atheisten. Oder man wûÊhlt die Religion, die leichter auszuû¥ben ist. Es wûÊre komisch, wenn ich plûÑtzlich Weihnachten feiern mû¥sste.
Judith Tarazi:
Ich glaube auch, das wird oft unterschûÊtzt. Sobald dir die Religion etwas bedeutet, wird es schwierig. Wenn man sagt, ich mache das nur aus Tradition, dann kann man es auch vermischen.
Tragen deine Schwestern eigentlich auch alle Kopftuch?
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Ja.
Judith Tarazi:
Solltet ihr das oder habt ihr euch selber irgendwann dafû¥r entschieden?
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Ehrlich gesagt wurde es nie thematisiert. Als Kind haben wir natû¥rlich alle keins getragen. Aber generell tragen die meisten ab der siebten Klasse eins, weil da der Schulwechsel ist. Meine Eltern haben nicht gesagt: "Jetzt trûÊgst du ein Kopftuch", aber es war einfach so: Nach dem Schulwechsel trage ich ein Kopftuch. Meine drei Nichten tragen alle keins. Eine Nichte hat es probiert und kam mit der gesellschaftlichen Marginalisierung nicht klar, sie hat mitbekommen, wie die MûÊdchen gehûÊnselt wurden. Ich wurde auch in der Schule gehûÊnselt, habe Arbeitsstellen deshalb nicht bekommen. Aber das ist eine Frage des Charakters. Ich habe keinen Grund gefunden es abzunehmen.
Gerade im pûÊdagogischen Bereich finde ich es widersprû¥chlich, den Menschen nicht so zu akzeptieren, wie er ist. Ich kann nicht einem Kind sagen: "Du bist gut so wie du bist", und dann sieht es mich auf der Straûe mit Kopftuch und an der Arbeitsstelle ohne.
Und du lebst deinen Glauben gar nicht aus?
Judith Tarazi:
Na doch, die Kinder sind auf der jû¥dischen Schule ã ich lebe nicht religiûÑs, aber ich richte mich schon danach, beachte die Feiertage. Die jû¥dischen Feiertage fangen immer einen Tag vorher an. Sobald die Sonne untergeht, werden die Kerzen angezû¥ndet. Das sind einfach wunderschûÑne Rituale.
Ayse-Gû¥l Yilmaz:
Das ist interessant. Bei uns ist es das Freitagsgebet, bei den Juden ist es der Samstag und bei den Christen der Sonntag. Ich habe mal gelesen: Es ist alles das Gleiche, nur ein Hauch von Unterschied. Der Weg ist anders, das Ziel ist das Gleiche.

Biografien

Ayse-Gû¥l Yilmaz ist Erziehungswissenschaftlerin. Sie hat mit Kindern und mit Frauen gearbeitet (u.a. in einer JVA und in einem interkulturellen Frauenprojekt) und beginnt demnûÊchst eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Sie ist 32 Jahre alt.

Judith Tarazi ist Grafikdesignerin und Kunsttherapeutin. Sie leitet das Kunstatelier Omanut, ein kû¥nstlerisch orientiertes Projekt fû¥r Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen. Ihre eigene Arbeit ist unter www.tarazidesign.de zu finden.
Weiterlesen auf AVIVA-Berlin:
Interview mit Judith Tarazi auf AVIVA Berlin
Dieser Beitrag wurde von den Autorinnen am Dienstag, 14. April 2014 im Rathaus Charlottenburg prûÊsentiert.
Auûerdem sprachen unsere Schirmfrauen des Projektes, die Senatorin fû¥r Arbeit, Integration und Frauen Dilek Kolat, sowie die Gleichstellungsbeauftragte Carolina BûÑhm, sowie die Initiatorinnen Sharon Adler und Claire Horst

"Lokale Geschichte(n) Charlottenburg-Wilmersdorf" wurde gefûÑrdert durch:
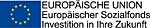



Copyright Fotos von Ayse-Gû¥l Yilmaz und Judith Tarazi: Sharon Adler
