AVIVA-Berlin >
Literatur
AVIVA-BERLIN.de im Januar 2026 -
Beitrag vom 13.07.2025
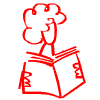
Launch des Digitalen Archivs jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin 1933–1945 (DAjAB)
AVIVA-Redaktion
Nach zehnjähriger Arbeit am Aufbau eines Digitalen Archivs jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin 1933–1945 (DAjAB) an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder wurde am 7. Juli 2025 das bahnbrechende und bislang in dieser Form einzigartige Portal vorgestellt.
Projektleiterin ist die Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr. Kerstin Schoor, Inhaberin des Axel Springer-Lehrstuhls für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte, Exil und Migration an der Europa-Universität Viadrina. Sie stellte in ihrer Online-Präsentation zahlreichen Kolleginnen und Kollegen und Interessierten das DAjAB umfassend vor.
Das Digitale Archiv jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin 1933–1945 (DAjAB) erfasst in derzeit über 1.000 Bio-Bibliografien erstmals die nach 1933 im NS-Berlin lebenden Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft, die unter den besonderen Bedingungen antisemitischer Ausgrenzung und Verfolgung durch die nationalsozialistische Politik und Kulturpolitik lebten und arbeiteten.
In dem auf einer relationalen Datenbank basierenden Portal sind derzeit ca. eine Million gespeicherte Informationen verzeichnet, um dem vergessenen literarischen Feld jener Jahre erste Konturen zu geben. Neben quellendokumentierten biografischen Informationen zu den Personen, werden deren vielfach nach 1945 nicht wieder aufgelegten Primärtexte (derzeit etwa 500 Bücher und tausende Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge) und ausgewählte Sekundärliteratur zu ihrem Schaffen verzeichnet. Es befinden sich darüber hinaus bereits über 4.000 digitalisierte Werke (als Bücher oder Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge aus den Jahren 1933–1945) sowie eine Anzahl von Originaldokumenten und Nachlassmaterialien im Portal.
Bereitgestellt werden über 400 Fotografien von DAjAB-AutorInnen (AutorInnen-Porträts) und perspektivisch auch einige Interviews.
Aufgenommen und verzeichnet wurden zudem über 1.110 kulturelle Veranstaltungen, Aktivitäten von etwa 2.200 Organisationen sowie Informationen über nahezu 2.800 Orte jüdischen Lebens in Berlin und dem Berliner Umfeld. Es bestehen Recherchemöglichkeiten sowohl innerhalb der erfassten Bestände (über interne Verlinkungen) als auch nach außen – zu internationalen Institutionen und Archiven, darunter auch The National Library of Israel.
Die Datenbank speichert dabei die biografischen und literarhistorischen Informationen in bemerkenswerter Detailtiefe: Zu einem Buch können Rezensionen und Lesungen ebenso wie Auszeichnungen und Zensurmaßnahmen verzeichnet werden. Es ist in einzigartiger Weise gelungen, diese Informationen vollständig auf der Webseite abzubilden. Eine AutorInnenseite kann Einträge aus 140 Kategorien ausgeben, wobei jeder Eintrag mit allen verknüpften Daten angezeigt wird. Das DAjAB kann auf seiner Website den NutzerInnen nicht nur eine Datenansicht bereitstellen, sondern es können – auf der Grundlage der relationalen Speicherung – eigenständig Zusammenhänge zwischen Personen, Organisationen und Orten aufgedeckt werden, indem jede Verknüpfung automatisch einen Link zu der entsprechenden Seite erhält.
Über die Suchfunktion können zudem sämtliche im Portal befindlichen Digitalisate mit der semantischen Volltextsuche durchsucht werden. Hierbei werden sowohl alle Textstellen gefunden, die den Suchbegriff enthalten als auch Stellen angezeigt, die thematisch ähnlich zu den Suchbegriffen sind.
Das Digitale Archiv jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin 1933–1945 (DAjAB) versteht sich damit als Beitrag zu einer lange vernachlässigten, kultur- und literaturgeschichtlichen Grundlagenforschung, die den in der NS-Zeit in Berlin lebenden Autorinnen und Autoren und ihren Werken wieder eine Stimme gibt. Es dokumentiert deren Verfolgungen ebenso, wie es sie als Schöpferinnen und Schöpfer einer Literatur sui generis kenntlich und ihr Schaffen erstmals wieder einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht. Es ist eine Fundgrube für Neu- und Wiederentdeckungen innerhalb eines noch weitgehend unerschlossenen literarischen Feldes, dem man über Jahrzehnte – vielfach ohne Kenntnis einschlägiger Primärtexte und anderer Quellen – mangelnde literarhistorische Relevanz bzw. künstlerisch-ästhetische Bedeutsamkeit unterstellte.
Zahlreiche dieser literarischen und kulturellen Aktivitäten werden zudem als Teil einer deutschsprachigen Literatur erkennbar, die im zeitgenössischen Diskurs der 1930er und beginnenden 1940er Jahre vor allem außerhalb Deutschlands auf die soziale Entrechtung, Ausgrenzung und Ermordung großer Teile des europäischen Judentums reagierte.
Die Angaben im Portal werden weiterhin ergänzt und überarbeitet. Wenn Sie über zusätzliche Informationen, Fotografien oder Unterlagen zu den Autorinnen und Autoren verfügen, freut sich das Projekt Team über eine Nachricht an info@dajab.de.
Gefördert wird das Digitale Archiv jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin 1933–1945 (DAjAB) von: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Friede Springer Stiftung, Alfred Landecker Foundation, Ursula Lachnit-Fixson Stiftung.
Das Digitale Archiv jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin 1933–1945 (DAjAB) ist online unter: www.dajab.de
Quelle: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 7. Juli 2025, www.europa-uni.de